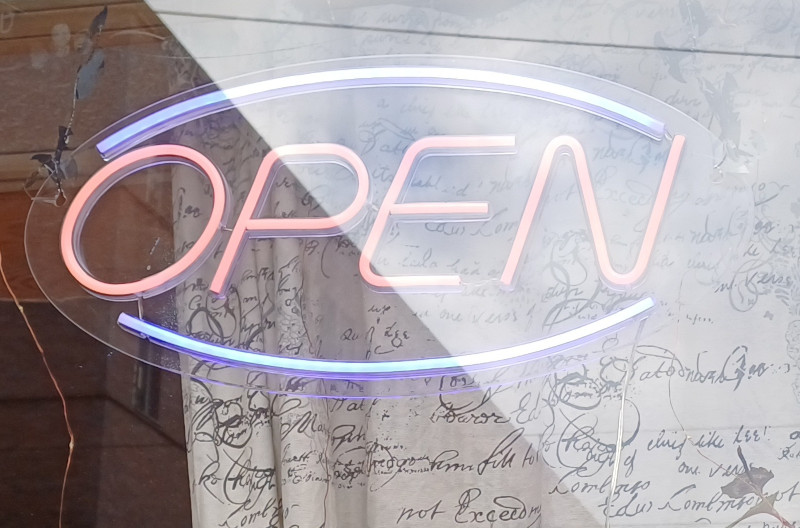
Disclaimer: wegen der anstehenden Bundestagswahl sind diesmal auch Quellen, die erst im Februar erschienen sind, mit eingeflossen.
80 Jahre Befreiung von Auschwitz
Am 27. Januar jährte sich die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz zum 80-ten Mal. Im Podcast des Auschwitz Memorials kann man mehr über die Vorbereitung der Befreiungsoperation und ihre eigentliche Durchführung erfahren, bei der schließlich 7.500 Gefangene, darunter 500 Kinder befreit werden konnten. Die wenigen erhalten gebliebenen Personalbögen, so genannten “Stärkebüchern” und Arbeitseinsatzprofilen dokumentieren die grausame Lagerverwaltungsmachinerie. Dass solche Dokumente überhaupt digitalisiert vorliegen ist auch vielen Freiwilligen zu verdanken. So haben in der diesjährigen Every-Name-Counts-Challenge des Arolsen Archives rund 60.000 Freiwillige geholfen, über 80.000 Dokumente zu digitalisieren, wie z.B. solche Häftlings-Personal-Karten. Auf der European Holocaust Research Infrastructure (EHRI) finden sich Metadaten zu weiteren Datensätzen. Digitale Werkzeuge, die im Zuge ihrer Forschung entstanden sind, stehen zudem Open Source auf Github. Auf victims.auschwitz.org lässt sich die Chronologie der Deportationen nachvollziehen.
Politische Debattenkultur
Trotz dieses Gedenktages, der auch im Bundestag begangen wurde, nahm die CDU/CSU-Fraktion gerade mal zwei Tage später billigend in Kauf, dass ihr Entschließungsantrag zur massiven Verschärfung der deutschen Migrationspolitik in der namentlichen Abstimmung nur durch die Stimmen der rechtsextremen AfD eine Mehrheit finden konnte. Gleiches gelang ihr am 31. Januar dann zum Glück nicht mit ihrem sogenannten “Zustrombegrenzungsgesetz”. Beides zudem Gesetze, die entweder europäisches Recht bzw. nationales Recht brechen würden, wie auch Der Paritätische Gesamtverband ausführt.
Warum solcher rechter Populismus dennoch erfolgreich ist, thematisieren Petter Törnberg und Juliana Chueri in ihrem Forschungsbericht, der Desinformation und rechtsradikalen Populismus in 26 Ländern an Hand 32 Millionen Politiker-Tweets untersucht hat. Sie kommen zum Schluss, dass es ein symbiotisches Verhältnis zwischen Populisten und der Aufmerksamkeitsökonomie der Clickbait-Medien gibt. Dabei werden die radikalen Ansichten / Lügen immer dreister verbreitet.
Die Erkenntnisse lassen sich auch auf Talkshows übertragen, sei es bei der Auswahl ihrer Gäste, als auch der gesetzten Themen, z.B. beim Kanzlerkandidatenduell, bei der Sicherheit mehr Raum einnahm, als die tatsächliche Entwicklung der letzten Jahre rechtfertigen würde und dagegen über die Klimapolitik gerade mal anderthalb Minuten gesprochen wurde. Kritischer Journalismus findet nicht mehr statt. Wie auch, wenn Redaktionen und Moderator:innen jahrelang im Geschäft sind, eigene Produktionsfirmen haben und mit ihrer sozioökonomischen Stellung kaum noch Bezug zum normalen Volk haben (Privilegierte interviewen Privilegierte, wie man Unprivilegierten noch mehr wegnehmen kann). Der Deutsche Kulturrat schlägt vor, dass Talkshows eine einjährige Pause einlegen und ihre Konzepte grundlegend überarbeiten sollten.
Gepaart mit dem Umstand, dass auch moderne Wahlkampfkampagnen immer stärker datengetrieben ausrichtet sind, höhlt dies unsere Demokratie weiter aus. So sammeln Parteien große Datenmengen über ihre potenziellen Wähler und leiten aus ihnen zielgruppengerechte Ansprachen ab, wie die Untersuchung der Ausgaben der Parteien zur Wahl 2019 in Großbritannien ergeben haben.
Dabei hat bereits 1969 der spätere Bundespräsident Walter Scheel erkannt: “Es kann nicht die Aufgabe eines Politikers sein, die öffentliche Meinung abzuklopfen und dann das Populäre zu tun. Aufgabe des Politikers ist es, das Richtige zu tun und dann populär zu machen.”
Stattdessen denken die Parteien nur von der Wand bis zur Tapete und überbieten sich in ihrem Aktionismus damit, wer mehr abschiebt. In ihrer Analyse der repräsentativen R+V-Langzeitstudie “Die Ängste der Deutschen” kommt Professorin Borucki zum Schluss: “Ein respektloser und taktisch motivierter Umgang untereinander verstärkt das Misstrauen in die Politik insgesamt.”
Bundestagswahl 2025
Tim Fangmeyer hat eine Linksammlung mit den wichtigsten Informationen zum Bundestagswahlkampf 2025 zusammengestellt. Im Folgenden wird es daher auch zu Überschneidungen aber auch Ergänzungen kommen.
Prognosen
Bei wahlen.info kann man sich einen Überblick über die in Deutschland aktiven Umfrageinstitute verschaffen. Die Seite thematisiert dabei auch deren Finanzierung, Eigentümerstuktur und teilweise nachgesagter Nähe zu Parteien, um so deren Unabhängigkeit bei ihren Prognosen besser beurteilen zu können.
Auf wahlkreisprognose.de kann man sich die Trends für die Wahlkreise auf Bundesebene als auch detailliert auf Bundesland-Ebene ansehen.
Ein sechsköpfiges Team aus Politikwissenschaftler:innen, das durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert wird, entwickelt wissenschaftliche Wahlprognosen auf zweitstimme.org.
Der Hamburger Informatiker Matthias Moehl bietet mit election.de eine weitere Wahlprognose, die auf einem eigenen Projektionsverfahren basiert, an.
Dass Umfrageergebnissen das Wahlverhalten beeinflussen, belegt dieser Deutschlandfunk-Artikel und mahnt daher zur Vorsicht mit den Vorhersagen. Es ist nicht immer absehbar, ob sie zu einem Bandwagon-Effekt (Mitläufereffekt) führen oder ob eher die Underdog-Hypothese (Außenseitereffekt) greift. Ein Signaleffekt besteht im jeden Fall und die Tendenz zur Selbsterfüllenden Prophezeiung. Und damit auch die Verleitung, Umfragen versuchen zu manipulieren (wenn auch vielleicht nicht so dreist, wie hier offengelegt).
Wahlenentscheidungshilfen
Faktenchecks und Analysen bietet der Wahlfang der Reporterfabrik.
Anna Biselli kritisiert auf netzpolitik, dass nur 30 Organisationen und Verbänden von den Parteien zugelassen worden sind, ihnen Fragen zu stellen. Aus diesen Frage-Antwort-Paaren ergeben sich die Wahlprüfsteine, über die man sich schnellen Überblick zu den Positionen der Parteien verschaffen kann. Durch diese enge Auswahl fehlten nun aber digitalpolitische Gruppen und ihre Themen. Daher gibt es von diesen nun eigene Angebote, denen sich weiter unten in diesem Blogpost noch gewidmet wird.
Sowohl Handelsblatt als auch t-online vergleichen die dieses Jahr verfügbaren digitalen Wahlentscheidungshelfer.
In den nächsten Abschnitten soll dennoch diese und weitere Alternativen aufgegriffen werden. Sie werden getrennt nach ihrem Ansatz behandelt.
Auf Basis der Parteiprogramme / direkten Antworten der Parteien
Beim Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) werden von auf Grundlage der Partei- und Wahlprogramme 38 relevante Thesen formuliert und den Parteien zur Beantwortung zugesandt. Der genaue Prozess ist hier dokumentiert. Thesen kann man zustimmen, ablehnen oder als neutral bewerten. Thesen, die einem besonders wichtig sind, kann man doppelt gewichten. Einem Nutzer in unserem Code-for-Germany-Netzwerks ist allerdings aufgefallen, dass die Seite ein Tracking-Pixel nutzt. Das Wahl-o-mat Team konnte aber glaubhaft versichern, dass das Pixel nur zum Zählen der Zugriffe dient und dass die IP-Adressen der Nutzenden in keinem Fall gespeichert werden. Stattdessen wird eine zufällige ID vergeben, die keinen Bezug zur IP hat. Die Anonymität ist somit definitiv gewährleistet.
Ähnlich funktioniert der Wahlswiper. Dieser hat ebenfalls 38 Fragen an die Parteien gestellt. Sie durften sie aber nur mit “Ja” oder “Nein” beantworten, enthalten war nicht möglich.
Von Prof. Dr. Norbert Kersting (Universität Münster) und seinem wissenschaftlichen Team wurde der Wahl-Kompass entwickelt. Auch bilden die Parteiprogrammen aber auch die Antworten der Parteien zu den daraus abgeleiteten Thesen die Basis. Im Gegensatz zu den beiden bisher behandelten Tools kann man hier wie in einem richtigen Fragebogen auf einer Skala seine Stärke der Zustimmung oder Ablehnung bzw. auch neutrale oder keine Meinung ausdrücken. Die eigene Position als auch die der Parteien wird schließlich in einem Diagramm in einem links/rechts-progressiv/konservativ-Schema eingeordnet, Einzelpositionen lassen sich aber auch vergleichen.
Der steuer-o-mat der smartsteuer GmbH hat aus den Wahlprogrammen 18 Fragen speziell zur Steuerpolitik abgeleitet. Diese wurden den Parteien aber nicht extra vorgelegt sondern man hat die Antworten aus den Aussagen in den Programmen abgeleitet.
Chatten mit Wahlprogammen
Bei Wahlweise kann man übergreifend mit den Wahlprogrammen der Parteien chatten. Da das Tool KI-basiert ist, fehlen allerdings in den Antworten Verweise auf die konkreten Textstellen in den jeweiligen Programmen und sollte daher immer Zweifel nochmal selbst nachgelesen werden.
Auch bei wahl.chat werden die Antworten auf Grundlage der Informationen in den öffentlich zugänglichen Partei- und Wahlprogrammen durch eine KI generiert. Die Seite weist entsprechend darauf hin, dass somit Antworten nie offizielle Parteiaussagen sein können, sie komplexe politische Positionen eventuell nicht umfassend abbilden, sie unter Umständen ungenau oder Fehlinterpretationen sein können.
Der Wahl-O-Tron 3.000, konfiguriert von Christoph Lauer (von Bündis90/Die Grünen) mit den Wahlprogramme der Parteien zur Bundestagswahl 2025, setzt direkt auf ChatGPT auf.
Wahlprogrammanalysen
David Kriesel hat aus den Anworten der Parteien beim Wahl-O-Maten eine Parteienlandkarte (Cluster-Graphen) errechnet, weist aber selbst auf die methodischen Schwächen seines Ansatzes hin.
Das Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) hat die Reformvorschläge der Parteien zur Bundestagswahl 2025 hinsichtlich ihrer finanziellen Auswirkungen untersucht - wen würden die Steuerpläne der Parteien entlasten? Der Datenjournalist René Bocksch vom statistischen Bundesamt hat die Daten des ZEW zur besseren Veranschaulichungen auf einen Musterhaushalt heruntergerechnet.
Der WWF hat die Parteien in seinem Zukunftswahl-Check hinsichtlich ihrer Aussagen in ihren Wahlprogrammen zu Klimaschutz und biologischer Vielfalt bewertet, aber auch ihre Haltung zur Reform der Schuldenbremse als notwendige Voraussetzung für die Umsetzbarkeit der anderen Forderungen.
Im NABU-Check werden neben Umweltthemen auch die Unterstützung von Zivilgesellschaft und Ehrenamt abgeprüft.
GermanZero unterzieht in den Wahlprogrammen aber auch im Wahlkampf geäußerten Aussagen einem Faktencheck.
Campact bietet mit seinem LGBTQ*-Check zur Wahl 2025 Einblick in die Haltung der einzelnen Parteien zu den Rechten queerer Personen.
Auf Basis der Kandidierenden
abgeordnetenwatch hat allen zur Bundestagswahl antretenden Kandidaten die gleichen 18 Fragen gestellt. Im Kandidierendencheck kann man die gleichen Fragen beantworten (mit stimme zu, lehne ab oder neutral) und bekommt nach Angabe seiner PLZ die Übereinstimmungen zu den Abgeordneten im Wahlkreis aufgeschlüsselt.
Die App Voto bietet zwar nur den Check für die Kandidaten im Wahlkreis Tübingen an, die Fragen und die Parteizugehörigkeit der Antwortenden kann aber darüber hinaus trotzdem etwas Orientierung geben.
Da es kein anderer Kandidatencheck gemacht hat, fragt der Volksverpetzer in seinem Check ab, welcher Kandidat für ein AFD-Verbot ist.
Der Fediverse Activity Tracker bietet zwar keinen direkten Kandidaten-Check, erfasst aber Accounts von Parteien und Politikern im Fediverse (konkret Mastodon) und deren Aktivität. Technisch umgesetzt wurde dies als SPARQL-Abfrage auf den Wikidata-Einträge (Parteizugehörigkeit, aktives Amt) und den Accountlisten der Instanzen, die hier gepflegt werden. Man könnte also über diesen Weg in direkten Kontakt mit den Parteien und Kandidaten treten und seine Fragen los werden.
Auf Basis von vergangenen Abstimmungsverhalten
In Wahlprogrammen kann man viel versprechen, aber wie sah das tatsächliche Abstimmungsverhalten von Parteien bzw. deren Abgeordneten in der vergangene Legislatur aus? Bei DeinWal zur Bundestagswahl 2025 kann man die Abstimmungen selbst nochmal durchspielen und mit denen der Parteien vergleichen.
Der Real-O-Mat von FragDenStaat funktioniert nach dem gleichen Ansatz. Auf einer eigenen Unterseite wird trotzdem nochmal ausführlich auf Zielsetzung und Methodik eingegangen, da es zum Teil zu Verwirrung und Kritik an den als überraschend empfundenen Ergebnissen gegeben hat. Durch die Fraktionsdisziplin oder im Fall der Regierung der notwendigen Koalitionstreue zum Erzielen von Mehrheiten im Parlament müssen Parteien / Abgeordnete im Zuge gefundener Kompromisse manchmal auch entgegen ihrer eigentlichen Meinung abstimmen. Das sollte man entsprechend beachten, wenn man die finale Auswertung betrachtet und im Zweifelsfall nochmal den Kontext von Entscheidungsfindungen betrachten. Das Abstimmungsverhalten hat trotzdem eine Aussagekraft, da es Rückschlüsse auf das Verhandlungsgeschick einzelner Parteien zulässt. Im Idealfall sollte in der Gesamtsumme aller Abstimmungen immer noch das Profil der Partei sichtbar sein. Wenn man sich aber zu häufig nicht gegen seine Koalitionspartner hat durchsetzen können (bzw. diesen Kompromisse hat abringen können) und stattdessen eher ein Krötenschluckautomat ist, dann nützen die besten Absichten im Wahlprogramm nichts. Am Ende ist ein:e Abgeordnete:r im Bundestag nach Artikel 38 GG “lediglich seinem Gewissen unterworfen”. Und wenn man meint dauerhaft gegen seine Überzeugung abstimmen zu müssen, nur um seinen Posten zu behalten, dann sollte man es besser ganz sein lassen.
Die Abstimmungen der für einen relevanten Abgeordneten kann man zudem auf [abgeordnetenwatch.de](https://www. abgeordnetenwatch.de/) nachvollziehen, indem man auf das Profil des jeweiligen Abgeordneten geht und dort den Reiter “Abstimmungen” öffnet.
Sonstige
Der Vollständigkeit halber sollen hier auch noch einige “Wahlhilfen” genannt werden, die entweder nicht ganz ernst gemeint sind (wie der postill-o-mat) oder auch parteipolitisch gefärbt sind (wie der radikal-o-mat.de von den Linken). Von den Linken in Auftrag gegeben wurde auch der Mietwucher-Check, der aber auch beim Mieterbund positiv aufgenommen wurde.
Forderungen Digitalpolitik
Zur Zukunft der Digitalpolitik hat unser Träger, die Open Knowledge Foundation in drei Blogposts Forderungen an die nächste Bundesregierung formuliert. Im ersten Teil geht es um die Forderung, die digitale Transformation offen zu gestalten, d.h. auf Open-Source-Ökosysteme als resiliente digitale Infrastruktur zu setzen, sowie auf moderne und zukunftsfähige Datenmanagementsysteme verbunden mit einem Rechtsanspruch auf Open Data. Digitalpolitik sollte generell als Gesellschaftspolitik verstanden werden.
Im zweiten Teil der Reihe wird die Forderung nach einem Bundes-Transparenzgesetz erneuert, das die bereitwillige Veröffentlichung staatlicher Informationen festschreiben soll. Zudem sollte der §5 des Urheberrechtsgesetzes in der Art modernisiert werden, dass die Definition davon, was ein amtliches Werk ist, viele Nutzungs- und Lizenzunsicherheiten bereits von Vornherein ausräumt. Es sollte zudem Grundsatz gefolgt werden: weniger Projektförderung, mehr Strukturförderung (also weniger Leuchtturmprojekte sondern langfristige Finanzierung von Infrastrukturen). Kommunen sollten mehr unterstützt werden, Kompetenzen aufzubauen, um zumindest informierte Entscheidungen bei öffentliche Ausschreibungen treffen zu können. Hier würde auch der organisierte Austausch über Best Practices und mehr kommunale Kooperationen auch zusammen mit der Zivilgesellschaft vor Ort helfen. So ließe sich auch das Vertrauen in die Institutionen wieder stärken.
Der letzte Teil beschäftigt sich mit der Rolle der Zivilgesellschaft und der Förderung von demokratischen Teilhabe. Dazu wird eine Reform des Gemeinnützigkeitsrechts vorgeschlagen, die für mehr Rechtssicherheit für gemeinnützige Organisationen sorgen soll. Klarere Regeln für die Anerkennung der Gemeinnützigkeit von Open-Source-Projekten würden ebenfalls helfen. Mit der Einführung eines Freiwilliges Soziales Jahr Digital könnten besonders junge Menschen mit Interesse an Digitalthemen gezielt gefördert werden. Dabei könnten gleich Open Educational Resources (OER) stärker gefördert werden. Generell sollte die Zivilgesellschaft stärker in Entscheidungsprozesse eingebunden werden, in dem sie z.B. in Entscheidungsgremien fest entsendet wird.
Auch das “Bits & Bäume”-Bündnis hat seine digitalpolitschen Forderungen formuliert: auch sie fordern ein Bundestransparenzgesetz und die Förderung von Open Source im Sinne von “Public Money – Public Code!“ zur Erlangung souveräner digitaler Infrastrukturen. Sie legen aber auch den Schwerpunkt auf eine ressourcenarme Digitalisierung, d.h. z.B. den Ressourcenverbrauch von künstlicher Intelligenz (KI) über den gesamten Lebenszyklus transparent zu machen oder auch durch nachhaltige öffentliche Förderung passende Innovationsanreize gesetzt werden. Digitalisierung macht auch nicht an Ländergrenzen halt, so dass entsprechend die EU-Lieferkettenrichtlinie umgesetzt werden muss, Wissens- und Technologietransfer in der Entwicklungszusammenarbeit priorisiert werden muss und Plattformarbeiter:innen besser geschützt werden müssen, indem die Europäische Richtlinie zur Plattformarbeit umgesetzt wird.
Oliver Bott, Projektmanager im Bereich “Digitalisierte Gesellschaft” der Stiftung Mercator, analysiert kritisch auf dem Blog von Civic Data Lab wie sich die Parteien in ihren Wahlprogrammen zu Themen wie Transparenz und Offene Daten, Kulturwandel hin zum Digitaler Staat und Rolle der Zivilgesellschaft positionieren.
Wahlenentscheidungshilfen Digitalpolitik
Noch etwas systematischer verfährt der Digital-Thesen-Check von D64 zur Bundestagswahl 2025, der die Positionen der einzelnen Parteien in ihren Wahlprogrammen zu 8 digitalpolitischen Thesen (Open Data by Default, Open Source Beschaffung, Gesichtserkennung, Vorratsdatenspeicherung, IT-Sicherheit, Hass im Netz, Anonymität im Netz, Barrierfreiheit) zuordnet.
Der Digital-O-Mat des Kleindatenvereins prüft analog zum Wahl-O-Mat 11 Digitale Themen ab. Der Code des Tools steht konsequenterweise auch Open Source.
20 Fragen hat der Bitkomat im Angebot. Im Bitkomat Check gibt es zudem Interviews mit Parteivertretern sowohl hier die Forderung der Bitkom.
Transparenz
Wie gehen Politiker mit potenziellen Interessenkonflikten um? Correctiv hat das Lobby-Netzwerk von Friedrich Merz untersucht. Der CDU-Slogan “Fleiß müsse wieder im Geldbeutel spürbar werden” sagt nicht aus, in wessen Geldbeutel. Welche Interessen wird Merz vertreten, wenn er Bundeskanzler werden sollte, wenn jetzt schon das CDU-Wahlprogramm teils wortgenau mit Forderungen der Chemie- und Metallindustrie übereinstimmt?
In einem ZDF-Beitrag wird zudem bemängelt, dass die Spitzenkandidaten der Parteien teilweise nicht ihre Aktienvermögen transparent offen legen. Wenn es nach Abgeordnetenwatch geht, sollte daher nach französischem Vorbild das Vermögen von Regierungsmitgliedern verpflichtend offengelegt werden, um mögliche Interessenskonflikte sichtbar zu machen.
Entwicklungen in den USA
Ein Vorgeschmack, was auch bei uns drohen könnte, zeigen die Entwicklung nach der Amtsübernahme von Donald Trump in den USA. Dass gewisse der eigenen Ideologie unliebsame Inhalte von Regierungsseiten entfernt werden (z.B. zu Klimawandel und Geschlechterpolitik), kannte man schon aus der ersten Amtszeit. So versuchen derzeit Aktivisten Datensätze zu retten, die gerade von data.gov verschwinden. Neben dem Ausstieg aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die damit nicht nur tiefe Finanzlöcher reißt, setzt die US-Regierung, konkret Elon Musk, nun auch die Arbeit der Verbraucherschutzbehörde aus. Elon Musks Abteilung für Regierungseffizienz (Department of Government Efficiency” (“DOGE”)) ist es auch, das eine KI mit sensiblen US-Regierungsdaten füttern möchte, um so massive Kostensenkungen abzuleiten. Zuvor erhielt er schon Zugang zu sämtlichen Daten des Zahlungssystems des US-Finanzministeriums, und damit zu persönlichen Daten von Millionen von Amerikanern, die Gelder von der Regierung erhalten, wie z.B. aus der Sozialversicherung oder Steuerrückzahlungen. Ob es dabei zu möglichen Interessenskonflikten (wie z.B. Einblick in Wirtschaftsdaten von Konkurrenten von Musks Firmen) kommt, möchte Musk für sich selbst entscheiden. Man nennt es auch Realsatire. heise hat zusammengefasst, zu welchen Daten Musk bereits Zugriff erlangt hat. Der gesamte Artikel beschreibt den de facto vollzogenen kalten Staatsstreich, während die Tagesschau und anderen Medien verharmlosend noch von “Bürokratieabbau” sprechen. Eryk Salvaggio analysiert auf Tech Policy Press den Coup (englisch für Staatsstreich / Putsch) auch hinsichtlich des Ansatzes Politik bzw. demokratische Entscheidungsprozesse durch KI zu ersetzen. Bereits 2018 wurde in der taz geschrieben, dass Musk einen guten James-Bond-Bösewicht abgegeben würde.
In Deutschland deutet sich bei einem Regierungswechsel eine Konstellation aus Trumpeltier mit digitalen Einflüsterer an.
Datenhandel außer Kontrolle
Mit dem Transatlantischen Datenabkommen wollte die EU-Kommission gewährleisten, dass die Daten der EU-Bürger:innen, auch wenn sie Apps aus den USA nutzen, dennoch vergleichbaren Datenschutzregeln wie in der EU unterliegen. Nach Antritt der Trump-Administration droht nun das in den USA zuständige Aufsichtsgremium, das Privacy and Civil Liberties Oversight Board (PCLOB) handlungsunfähig gemacht zu werden, da nun einzelne, einst von den Demokraten entsandte, Mitglieder gezwungen werden, von ihrem Amt zurückzutreten.
Recherchen des BR zusammen mit internationalen Partnermedien legen offen, dass Millionen von Standortdaten an Datenhändler abgeflossen sind. Der vom US-Datenhändler Datastream als kostenloses Anschauungsmaterial weitergegebene Datensatz enthält 380 Millionen Standorte von 47 Millionen Nutzern aus 137 Ländern an einem Tag im Juli 2024. Aus den Daten ist neben den Werbe-Kennungen (Mobile-Advertising-IDs) auch ersichtlich, aus welchen der insgesamt 40.000 Apps die Standorte jeweils mutmaßlich stammen, darunter Apps wie Wetter Online, Focus Online und Kleinanzeigen. Die App-Anbieter teilen die Informationen in Echtzeit an Vermarkter von Online-Werbeanzeigen, aber auch an Unternehmen mit anderen Motiven. Die Datenschutzbestimmungen von Wetter Online listen 850 Firmen, denen es die Daten weitergibt, auch außerhalb der EU nach USA, Hongkong, Singapur oder Brasilien. In einem langen Netzpolitik-Artikel wird auf weitere Details eingegangen, unter anderem wurden die App-Betreiber um eine Stellungnahme gebeten. Martin Baumann von der Datenschutzorganisation noyb spricht von einem “enormen Kontrollverlust”. Mit dem Databroker-Checker kann man überprüfen, ob die eigene Werbe-ID im besagten Datensatz vorkommt.
Vergleichbar mit dem bei 38C3 publik gemachten VW-Datenleak wurden nun auch bei Subaru eine riesige Standortdaten-Sammlung entdeckt.
Digitale Souveränität
Mit dem internationalen Aufruf “Free our Feeds”, unterstützt unter anderen von der Führung von Wikimedia und Mozilla, soll eine Stiftung entstehen, die ein offenes Ökosystem für soziale Medien auf Basis von Open Source und offener Protokolle etablieren möchte, das nicht von einzelnen Firmen oder Milliardären kontrolliert - “Protokolle statt Plattformen”. Über die Stiftung soll Geld für die Expansion eines solchen Ökosystems eingesammelt werden. In eine ähnliche Richtung geht auch der deutsche Aufruf “Soziale Netzwerke als demokratische Kraft retten”.
Dass die großen Plattformen solche freien Alternativen gar nicht mögen, zeigt sich daran, dass Facebook nun Links zur Instagram-Alternative Pixelfed (Instanzen z.B. pixelfed.de und pixelfed.social) als Spam markiert und sperrt. Gleiches hatte Twitter / X schon zuvor mit Links zur Alternative Mastodon getan. Von Pixelfed wird übrigens bald mit loops.video auch eine Alternative zur Kurzvideo-Plattform Tiktok geben.
Wer nur Cloud Dienste nutzen möchte, die europäischen Richtlinien unterliegen, wird auf der Seite European alternatives for digital products fündig.
Wer seine privaten Fotos und Videos in der Cloud verwalten möchte und nicht auf den Komfort verzichten möchte, den Dienste wie Google Photos oder iCloud geboten haben, kann nun auf die Open Source Lösung immich (Quellcode auf Github) wechseln, die man datenschutzfreundlich selbst hosten kann.
Das Zentrum für Digitale Souveränität der Öffentlichen Verwaltung (ZenDiS) hat eben sein einjähriges Bestehen gefeiert. Pünktlich zum Geburtstag wurde auch der Relaunch von openCode fertig, auf der man weiterhin Open-Source-Lösungen für die öffentliche Verwaltung entdecken bzw. innerhalb der Verwaltungs-Community gemeinsam weiterentwickeln kann. Eine Videoaufzeichnung der Veranstaltung sowie die Präsentation der Vortragenden findet man hier.
Auf europäischer Ebene beinhaltet code.europa.eu nun mehr als 200 Open Source Projekte, die sich wiederum in 755 Code Repositories zergliedern, wie auf interoperable-europe berichtet wird.
Der Programmierer Sven Seeberg ist der erste Stipendiat des in der Münchner Verwaltung neu eingeführten Open-Source-Sabbaticals. In diesem kann er nun im ersten Halbjahr 2025 weisungsungebunden und freigestellt von anderen Verpflichtungen an einem Open-Source-Projekt arbeiten, das der Stadt und der Allgemeinheit zugutekommt.
Nicht digital souverän ist dagegen das Schweizer Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL): dieses muss weitere drei Jahre mindestens 93 Millionen Euro und optional noch bis zu 58 Millionen Euro an Microsoft für zeitlich befristete Softwarelizenzen zahlen. Der Auftrag dazu wurde ohne bei solchen Umfängen üblicher Ausschreibung vergeben und zwar mit folgender Begründung: “Aufgrund von Interoperabilitäts- und Kompatibilitätsanforderungen, der tiefen Integration in die bestehende Systemlandschaft sowie den vielschichtigen Abhängigkeiten bei den Fachanwendungen gibt es derzeit keine Alternative, mit der der anforderungsgemäße und lückenlose Betrieb sichergestellt werden könnte.”
Smart City
Im Rahmen des Förderprogramms Smart Cities sind seit 2019 inzwischen 650 Einzelmaßnahmen in 73 Modellprojekten entstanden und zeigen aus Sicht der Parlamentarischen Staatssekretärin Elisabeth Kaiser, dass auch deren Skalierung und langfristige Verstetigung funktionieren kann. Sie weist darauf hin, dass der Bund verfassungsrechtlich Kommunen nur in Modellprojekten direkt fördern darf (so aber notwendige Impulse setzen kann), flächendeckende Maßnahmen müssten die Bundesländer selber stemmen. Von den bis Juni 2024 so entstandenen 186 Lösungen konnten 112 erfolgreich auch in andere Kommunen übertragen werden. Für den langfristigen Betrieb muss man nun aber, noch bevor die Förderung ausläuft, geeignete Organisations- und Betriebsmodelle finden, bei denen die stadteigenen Betriebe oder professionelle Dienstleister aus der IT-Wirtschaft einbezogen werden müssen.
In seiner letzten Sitzung hat der IT-Planungsrat das Zielbild der OZG-Rahmenarchitektur beschlossen, unter anderem mit der Vision: “Alle Daten und Informationen sind aktuell, vollständig, konsistent, maschinenlesbar und werden bei der Übertragung Ende-zu-Ende verschlüsselt.”
Open Data
Mister Open Data erklärt auf seinem Blog, was es mit dem “Harvesting” auf sich hat.
Die Daten zu Gebäude- und Wohnungszählung sowie der Personenerhebung aus dem Zensus 2022 sind nun für jeden der 299 Wahlkreise in Deutschland verfügbar. Diese Daten können durchaus interessant für Politik, Wahlforschung und Wahlberichterstattung sein.
Alle (aktuell: 385.163) geologischen Bohrungen in Schleswig-Holstein kann man übrigens auch über das Open Data Portal beziehen. Auf dem Kartenserver des Niedersächsisches Bodeninformationssystems (NIBIS), der auch Daten für Hamburg, Bremen und eben Schleswig-Holstein zeigt, kann man sich diese Bohrungen auch auf einer Karte einblenden lassen.
In Moers haben die Frequenzmessungen zu Fußgängerinnen und Fußgängern in der Fußgängerzone in der Moerser Innenstadt für das Jahr 2024 in das Open Data Portal der Stadt Eingang gefunden.
Mit der Python-Konsolen-Anwendung DCAT Catalog Check, die letzten Monat Open Source veröffentlicht wurde, kann man die Gültigkeit von Verlinkungen in DCAT-Katalogen (also Open Data Portale bzw. -Kataloge, die ihre Daten und Dienste gemäß dem Metadatenmodellstandard Data Catalogue Vocabulary (DCAT) beschreiben) überprüfen.
Mit der OpenPLZ API können Straßen- und Postleitzahldaten (inklusive Gemeindedaten) für Deutschland, Liechtenstein, Schweiz und Österreich über eine offene REST-API-Schnittstelle abgefragt werden.
Das Land Berlin bietet einkommensschwachen Menschen zahlreiche Aktivitäten in den Bereichen Kultur, Sport, Bildung und Freizeit ermäßigt oder sogar kostenlos an. Viele Menschen kennen diese Angebote nicht, obwohl sie sogar in einem offenen Datensatz beschrieben werden. Beim CityLab Berlin hat man es sich daher zur Aufgabe gemacht, deren Sichtbarkeit durch eine eigene Recherche-App zu erhöhen. Doch diesmal sollte, nicht wie sonst, eine separat gehostete Prototyp-App entstehen, sondern die App direkt unter der berlin.de Domäne laufen. Die Herausforderung, den engen gestalterischen Look-&-Feel-Vorgaben zu genügen, wurde gemeistert und nun viel Fairgnügen!
Der Zauber der Dataviz(ards)
Erst geeignete Visualisierungen und Interaktionsmöglichkeiten helfen Daten überhaupt begreifbar zu machen. Eine Einführung in diese Kunst, das Unsichtbare sichtbar zu machen, gibt Anna Meide in der neuesten ODIS-Kolumne.
Viele spannende Visualisierungen zu aktuellen Themen enthält auch wieder der Data Vis Dispatch.
Tief eintauchen kann man mit dieser etwas anderen Büchersuche.
Auf der Blog “Soziale Wirkung” wird das nützliche Open Source Werkzeug Quarto ausführlich vorgestellt. Mit ihm lassen sich Datenanalysen (wahlweise in R, Python, Julia oder Observable) in Dokumente und Präsentationen, die man mit Markdown schreibt, einbetten. Sie lassen sich schließlich als HTML oder PDF, aber auch als Word-Dokument oder PowerPoint sowie für Revealjs und noch in viele andere Output-Formate exportieren. Quatro-Dokumente können modular aufgebaut werden, so dass man gut mit Vorlagen arbeiten kann. Zudem gibt es inzwischen zahlreiche Erweiterungen, wie z.B. Closeread für das Erstellen von Daten-Storys.
Wikiverse
An ein vielleicht nicht allzu bekanntes Detail aus den Anfängen der Wikipedia erinnert ein Nutzer auf Mastodon: so wurde ein Jahr nach Gründung in Erwägung gezogen, mit dem Einbinden von Werbeanzeigen den Weiterbetrieb zu finanzieren. Erst ein Streik der spanischen Editoren und dem angedrohten Abzweigen einer eigenen Spanischen Wikipedia-Variante, lenkte der Gründer Jimmy Wales ein, und bewahrte die Gemeinnützigkeit des Projekts.
Im Januar stellte Jona Hölderle im Rahmen eines Civic Data Lab Expresso-Talks vor, wie Nichtregierungsorganisationen (NGOs) offene Daten (und im Speziellen Wikidata) sinnvoll nutzen und vernetzen können. Die Präsentation ist auch im Nachbericht verlinkt.
Jens Ohlig hat den SPINACH Wikidata Agent für sich entdeckt, um mit dem LLM bequem in natürlicher Sprache Wikidata-SPARQL-Abfragen generieren zu können.
Einen anderen Ansatz, SPARQL-Abfragen zu strukturieren und auszuführen, verfolgt Benjamin Degenhart mit semOps. Mit diesem Werkzeug werden Operation als Datenfluss modelliert, wie er in einem Video vorstellt.
Wie man Wikipedia und Wikidata auch spielerisch nutzen kann, stellen Corinna Schuster und Patrick Wildermann an Hand der Beispiele Notable People (ein Globus mit Geburtsorten berühmter Personen) und Wikipedia Speedruns (möglichst schnell (bzw. wenigen Klicks) von einem vorgegebenen Wikipedia-Artikel zu einem ebenfalls vorgegebenen Ziel-Wikipedia-Artikel durch das geschickte Verfolgen von Verlinkungen navigieren) in ihrem Blogpost vor. Ein weitere Anwendung ist dieser Wikidata-basierte Zugfahrt-Sehenswürdigkeiten-Anzeiger.
Open access
Das Public Domain Image Archive enthält gemeinfreie Bilder zum Weiternutzen, Nele Hirsch findet das sehr hilfreich.
Noch mehr Bilder findet man im Marburger Bildarchiv: dank einer OpenAccess-Initiative in Folge der Urheberrechtsnovelle 2021 findet man seit Januar nun dort 1,2 Millionen Fotografien kostenlos und unter freier Lizenz.
Eine Einführung in Open Science gibt der folgende Vortrag.
Klima
Globale Erwärmung
Nach Auswertung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) war das vergangene Jahr 2024 erneut das wärmste je gemessene. Zeit Online bietet zur besseren Veranschaulichung der Daten unter anderem eine Deutschlandkarte an.
Global wurde 2024 erstmals die 1,5-Grad-Temperaturschwelle überschritten, damit ist das 1,5-Grad-Ziel zwar noch nicht gerissen, da dieses sich auf einen Langzeitdurchschnitt über Jahrzehnte bezieht, bringt uns dieser Gefahr aber deutlich näher. Im BBC-Bericht sind einige Grafiken enthalten, die den Ernst der Lage verdeutlichen, unter anderem auch dieses Diagramm, das die Verteilung der Abweichungen der Tagestemparaturen vom präindustriellen Mittel über die letzten 85 Jahre zeigt. So lagen 2024 die meisten Tage über der 1,5 Grad Abweichung. Allein der letzte Dezember war laut Copernicus-Auswertung des ERA5-Datensatzes der zweitwärmste nach 2023 mit 1,69 °C über den Dezember-Temparatur-Durchnitt der Jahre 1850 bis 1900.
Auf der Seite des Climate Reanalyzers des Klimawandelinstituts der Universität Maine sieht man die täglichen Oberflächentemparaturen der Meere. Fährt man mit der Maus die rechte Skala mit den Jahreszahlen entlang, ist auch hier ein besorgniserregender Trend zu erkennen.
Weitere Details kann man dem jährlichen Klimabericht entnehmen, unter anderem dass die Ausdehnung des Meereis am Südpol auf nahezu auf dem gleichen niedrigen Stand wie 2023 geblieben ist.
Derzeit ist climate.gov noch eine verlässliche Quelle zu Forschungsdaten über die Erderwärmung, aber nach dem Regierungswechsel fürchten einige, dass sich Desinformation mehren könnte.
Auch Waldbrände, wie die in und um Los Angeles im Januar, werden durch den Klimawandel wahrscheinlicher, wie eine neue Attributionsstudie berechnet hat. Brandursache ist meist absichtliche oder fahrlässige Brandstiftung, nur 5% entstehen durch Blitzeinschlag. Über Monate ausgetrocknete Wälder bilden nun aber leicht brennbares Material und starke Winde sorgen zusätzlich dafür, dass sich die Feuer schnell ausbreiten können.
Monitoring Luftqualität
In der Stadt Asunción in Paraguay nimmt die Luftverschmutzung von Jahr zu Jahr zu. Mit dem Projekt Project Respira, das von der Mozilla-Stiftung gefördert wird, soll nun mit Hilfe von Open Data und der Zusammenarbeit von Zivilgesellschaft, Wissenschaft und der Open-Source-Gemeinde Luftqualitäts-Vorhersagen mittels Machine Learning errechnet werden. Diese sollen der Bevölkerung über eine Webseite, aber auch durch Chatbots und Social-Media-Bots bereitgestellt werden, so dass sie informierte Entscheidungen treffen, auf wann sie ihre Aktivitäten im Freien legen, um ihre Gesundheit am besten zu schützen.
Ertan Özcan berichtet von seinem OpenData- und IoT-Projekt in Köln, mit dem er einfach die Feinstaubbelastung und Luftqualität von seinem Balkon aus überwachen kann.
Positive Meldungen
Die Suchmaschine für Umwelt- & Naturschutz-Wissen, umwelt.info, ist am 27.1. offiziell freigegeben wurden. Man kann sich die Aufzeichnung des Launch-Events hier anschauen. Mehr Hintergründe gibt es im Deutschlandfunk-Interview mit dem Umweltbundesamt-Präsidenten Dirk Messner. Wie man mit den Suchergebnissen arbeiten kann, zeigt ein Artikel am Beispiel von Flusspegeldaten.
Die 2024 aus dem Emissionshandel erzielten Rekordeinnahmen von 18,5 Milliarden Euro fließen vollständig in den Klima- & Transformationsfonds und leisten so ihren Beitrag zur Erreichung der energie- und klimapolitischen Ziele, wie z.B. mehr Klimaschutz, Technologieförderung und sozialen Ausgleich.
Wie Malte Kreutzfeld ausführt, ist die Entwicklung im Wärmesektor deutlich besser, als die allgemeine Wahrnehmung vermuten lässt. So werden in 2/3 der Neubauten mittlerweile Wärmepumpen verbaut, der Anteil an Wärmepumpen im Bestand blieb stabil bei 27%, obwohl weniger verkauft wurden. In der Absatzstatistik fehlen allerdings noch die Wärmepumpen, die noch von 2023 im Lager waren und erst jetzt verbaut wurden, sowie die Luft-Luft-Wärmepumpen, die fast 25% der Förderanträgen der KfW ausmachen. Zudem ist die neue KfW-Förderung erst schrittweise angelaufen.
In der Europäischen Union war 2024 der Anteil fossiler Energien am Strommix so klein wie noch nie gewesen. Laut einem Bericht der Denkfabrik Ember wurden unter 10% des Stroms durch Kohle erzeugt, 16% durch Gas, sowie etwa 4% aus Öl oder Müllverbrennung. 24% wurden aus Atomkraft gedeckt. Dagegen stehen 11% Strom aus Solarenergie und 17% aus Windkraft. Die restlichen knapp 20% kamen aus Wasserkraft und Biomasse. Damit kommt fast die Hälfte des Stroms aus erneuerbaren Energien.
In einer Online-Umfrage haben etwa 18.000 Teilnehmende angegeben, was ihnen bei der Energiepolitik nach der Wahl wichtig ist. Der Mehrheit ist das Ziel eines klimaneutralen Energiesystems bis 2045 wichtig, 53% wären auch bereit einen höheren Tarif dafür zu bezahlen.
Mobilität
Das Vergleichsportal Verivox hat errechnet, dass das Laden eines E-Autos zu Hause um 47% billiger war, als einen Benziner aufzutanken und immer noch 38% billiger als Diesel zu tanken.
Am 30. Januar 2024 starb der Fahrradaktivist Natenom, bürgerlich Andreas Mandalka, nachdem er auf dem Rad von einem Autofahrer in einem Unfall von hinten angefahren wurde. In einer stillen Gedenkfahrt gedachten ihm am 2. Februar in und um Pforzheim hunderte Fahrradfahrer:innen. Frank Hellriegel vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) reiste dazu extra aus Leipzig an. Mit dieser Gedenkaktion soll auch darauf aufmerksam gemacht werden, dass es viel mehr sichere Radwege braucht.
Die alte HAFAS API der Deutschen Bahn wird bald nicht mehr verfügbar sein. Das bedeutet, dass alle Programme, die sie bisher für die programmatische Abfrage von Ankünfte, Abfahrten und generell Fahrplanauskünften genutzt haben, wie z.B. db-rest auf Alternativen wie z.B. die API des db-vendo-client wechseln müssen. Die neuen APIs haben aber deutlich niedrigere Rate-Limits, so dass geeignete Strategien gesucht werden müssen, diese einhalten zu können.
WoBahn ist eine neue Web-App, die die Wiener Linien Echtzeitdaten nutzt, um die ungefähren Standorte aller U-Bahn-Linien in Wien anzuzeigen. Die App steht auch Open Source auf Github.
Karten
Der GeoObserver macht auf das Angebot von Open Maps For Europe 2 (OME2) aufmerksam, das amtliche Geokatasterdaten als Open Data bereitstellt. Allerdings muss man sich einen Zugangstoken per Mail zuschicken lassen, um die APIs mit diesen dann nutzen zu können, wie weiter auf dem Blog beschrieben ist und man auch in den offiziellen FAQs nachlesen kann.
Seit Jahresbeginn haben mindestens 1.750.000 (Stand 16.2.2025) Menschen bundesweit gegen rechts demonstriert, wie die taz in ihrer Karte der Demos gegen Rechts dokumentiert. Auch Volksverpetzer, demos-gegen-rechts.de und DemokraTEAM erfassen die Demos. Nach dem Aufruf der Verlage gegen Rechts für Plakate gegen Rechts sind hunderte Einsendungen eingegangen: Über 300 dieser eingesendeten Plakate können nun für nicht-kommerzielle Zwecke frei verwendet werden.
Finanzen
Das Vergleichsportal der Bafin für Girokonten ist online.
Ein offener Brief fordert von der Europäischen Zentralbank (EZB) eine grünere Geldpolitik.
Medizin
Auch in Form eines Offenen Briefes sind die fünf Forderungen an den Gesundheitsministers formuliert, um das Vertrauen in die elektronische Patientenakte (ePA) zu erhöhen. Darunter auch die Forderung, alle Quelltexte zu veröffentlichen und eine Testumgebung bereitzustellen, damit die digitale Zivilgesellschaft eine belastbare Bewertung von Sicherheitsrisiken vornehmen kann.
Berichte, wie den aus Dänemark, wo bei einem Datenleck persönliche Patientendaten öffentlich wurden, sollten Warnung genug sein.
In einem weiteren offenen Brief, auf den in der Dicke Bretter Podcastfolge verlinkt wurde, wird generell die Digitalisierung im Gesundheitswesen thematisiert und in 10 Prüfsteine die Mindestanforderungen formuliert.
KI
Die neue Plattform parlament.fyi fasst politische Debatten und Abstimmungen im österreichischen Nationalrat mit Hilfe von großen Sprachmodellen zusammen und versieht sie mit Labels. Dabei bleiben die Originalquellen erhalten.
In diesem Mastodon-Thread werden GPT Modelle/Projekte, die entweder von bzw. für die öffentliche Verwaltung entwickelt wurden, gesammelt.
Ertan Özcan diskutiert die Möglichkeiten von GeoAI in der öffentlichen Verwaltung, wie automatisierte Kartierung (inklusive Objekterkennung), prädiktive Analysen wie Hochwassersimulationen und Umweltüberwachung wie Luftqualitätsdatenanalyse, Effiziente Stadtplanung (Optimierung der Standortwahl, Verkehrssteuerung).
Im reframeTech-Projekt der Bertelsmannstiftung gibt eine Wissensseite einen Überblick über das Ökosystem von KI-Basismodellen.
Ingo Hinterding vergleicht frei verfügbare Large Language Models (LLMs) hinsichtlich ihrer Eignung für deutschsprachige Texte. Diese hängt stark vom jeweiligen Anwendungsfall ab. Die getesteten LLMs werden hier gegenüber gestellt.
Mit dem AI Act sollten die Grundrechte aller EU-Bürger:innen vor den Gefahren sogenannter Künstlicher Intelligenz geschützt werden. Die Forschungsgruppe Corporate Europe Observatory bemängelt nun aber, dass sich die Unternehmen die Normen für KI-Systeme quasi selbst schreiben. Wenn nun die ersten Regeln aus dem AI Act Anfang Februar in Kraft treten, sind auch viele Schlupflöcher enthalten, legt dieser Gastbeitrag offen.
KI-Tools zu nutzen ist bequem. Doch eine neue Studie des Zentrums für Strategische Unternehmensvorausschau und Nachhaltigkeit der SBS Swiss Business School zeigt auch die negativen Folgen auf die Fähigkeit zum kritischen Denken.
Recap
Mitglieder aus dem Open Knowledge Foundation Netzwerk schilderten am 14. Januar in einem Online-Meeting ihre Eindrücke zu den in ihren jeweiligen Ländern durchgeführten Wahlen und den Gefahren von KI und Desinformation während der Wahlkämpfe, aber auch z.B. fehlende offene Daten zu den angetretenen Kandidaten.
Die entstandenen Projekte beim Berlin Hack & Tell sind hier gelistet.
Und sonst so
Anlässlich des 42-jährigen Bestehens des CCC wurden 12 Kunstprojekte, die positive Zukunftsvisionen entwickeln, mit 420€ bis 4200€ unterstützt.
Call for Participation
- Open Data Day 2025 – Mini-Grants Open Call, bis 23.02.2025
- Easterhegg 2025, Einreichungen bis 01.03.2025:
- Die FemNetzCon 2025 findet vom 4. bis 6. April 2025 in Neu-Ulm im temporärhaus statt, Anmeldeschluss: 24. Februar 2025!
Veranstaltungen
- Samstag, 01.02.2025, 09:00, bis Sonntag, 02.02.2025, 17:00, Université libre de Bruxelles (ULB) Solbosch Campus, Avenue Franklin Roosevelt 50, 1050 Brüssel und auch online: Free and Open Source Developers European Meeting (FOSDEM 2025) 📅
- Dienstag, 04.02.2025, 09:00-11:00, online: Annotierte Daten im Umweltbereich – Lessons Learned aus dem Projekt LabelledGreenData4All 📅
- Dienstag, 04.02.2025, 20:00-22:00, c-base, Rungestraße 20, 10179 Berlin und auch online: 143. Netzpolitischer Abend 📅
- Dienstag, 04.02.2025, 10:00-14:00, Einstein Center Digital Future (ECDF), Wilhelmstraße 67, 10117 Berlin: Ist die deutsche Wissenschaftslandschaft ein starker Motor für Open Science? 📅
- Donnerstag, 06.02.2025, 18:00-21:00, WikiBär Wikipedia, Köpenicker Straße 45, 10179 Berlin: Jugend editiert 📅
- Donnerstag, 06.02.2025, 18:00-21:00, Bitwäscherei, Neue Hard 12, 8005 Zürich (Schweiz): Jugendlab 📅
- Donnerstag, 06.02.2025, 19:31-20:30, online: Bits & Bäume Community Vernetzungstreffen 📅
- Montag, 10.02.2025, 09:00, bis Freitag, 14.02.2025, 15:00, online: forschungsdaten.info Love Data Week 2025 📅
- Montag, 10.02.2025, 19:00-22:00, WikiBär Wikipedia, Köpenicker Straße 45, 10179 Berlin: Code for Berlin 📅
- Dienstag, 11.02.2025, 14:00-15:30, online: Offenheit reicht nicht aus – Auf dem Weg zu einer lebendigen Datenkultur 📅
- Dienstag, 11.02.2025, 10:00-12:00, online: 17. Open Data Netzwerktreffen 📅
- Donnerstag, 13.02.2025, 11:00-12:00, online: Barrierefrei unterwegs: Wo stehen wir bei der Umsetzung des BehiG im Open Data-Bereich und welche Fortschritte gibt es bei Aufzugstörungen? 📅
- Donnerstag, 13.02.2025, 18:00-21:00, Weizenbaum-Institut, Hardenbergstr. 32, 10623 Berlin: Watching You – Die Welt von Palantir und Alex Karp 📅
- Donnerstag, 13.02.2025, 19:00-22:00, Wikimedia Deutschland e. V., Tempelhofer Ufer 23-24, 10963 Berlin: tech from below - 10. Treffen 📅
- Freitag, 14.02.2025, 18:00, bis Sonntag, 16.02.2025, 21:00, Wikimedia Deutschland e. V., Tempelhofer Ufer 23-24, 10963 Berlin: Berlinale Edit-a-thon 2025 📅
- Freitag, 14.02.2025, 19:00, bis Sonntag, 16.02.2025, 21:00, Jugendzentrum Nord (JuNo), Lintforter Straße 132, 47445 Moers: I Love Free Software Day Community-Hackday 📅
- Freitag, 14.02.2025, 18:00, bis Sonntag, 16.02.2025, 21:00, Geofabrik, Amalienstraße 44, 76133 Karlsruhe: Karlsruhe Hack Weekend February 2025 📅
- Dienstag, 18.02.2025, 18:00, bis Donnerstag, 27.02.2025, 19:10, online: Data Reuse Days 2025 📅
- Mittwoch, 19.02.2025, 20:00-21:30, online: Open Transport Meetup: Mobility Database and Canonical GTFS Schedule Validator 📅
- Donnerstag, 20.02.2025, 12:00-12:45, online: Espresso Talk: Aufbruch ins (Un)Bekannte: reale Mehrwerte durch strukturierte Daten schaffen - am Beispiel FörderFunke 📅
- Freitag, 21.02.2025, 10:00, bis Samstag, 22.02.2025, 16:00, OpenSource Science B.V., Etnastraat 20, 4814AA Breda (Niederlande) und auch online: Foss FEST 2025: International Hackathon 📅
- Dienstag, 25.02.2025, 17:30-20:30, KI-Ideenwerkstatt für Umweltschutz, Rollbergstr. 28A, 12053 Berlin: Unterwegs in die Kreislaufgesellschaft: Wie kann KI Bürger*innen dabei helfen, Stoffkreisläufe zu schließen? 📅
- Dienstag, 25.02.2025, 19:30-21:00, online: Verkehrswende-Meetup 📅
- Donnerstag, 27.02.2025, 11:00-12:00, online: openCode Connect Februar 2025 📅
- Donnerstag, 27.02.2025, 14:00-15:00, online: CorrelCompact: So lügt man mit Statistik 📅
- Freitag, 28.02.2025, 19:00, bis Samstag, 01.03.2025, 21:00, Casinotheater Winterthur, Stadthausstrasse 119, 8400 Winterthur (Schweiz): Winterkongress der Digitalen Gesellschaft Schweiz 📅
- Freitag, 28.02.2025, 19:00, bis Samstag, 01.03.2025, 21:00, WIR-Haus, Wilhelmstraße 189, 42489 Wülfrath: Hack im Pott 📅
- Samstag, 01.03.2025, bis Samstag, 08.03.2025, 23:59, online: Open Data Day 2025 📅
- Samstag, 01.03.2025, 10:00, bis Samstag, 08.03.2025, 21:00, Aktivitetshuset, Norderstraße 49, 24939 Flensburg: Open Data Day Flensburg 2025 📅
- Mittwoch, 05.03.2025, 09:00-15:00, FH Technikum Wien, Höchstädtplatz 6, 1200 Wien: Open Data Expo 2025 📅
- Donnerstag, 06.03.2025, 14:00-16:00, online: Einführung in die digitale Erschließung“ 📅
- Regelmäßige OKLab-Treffen
- Flensburg: jeden Mittwoch, 18:00, Aktivitetshuset, Hinterhaus, Norderstraße 49, Flensburg 📅
- Köln: jeden zweiten Montag, 19:00, Hackländerstr. 2 (Wikipedia Lokal K) 📅
- Leipzig: jeden Mittwoch, 19:00, Peterssteinweg 14 (Basislager) 📅
- Münster: jeden Dienstag, 19:30, Wolbeckerstr. 36 (Café Drei:klang) 📅
- Niederrhein: jeden Dienstag, 20:00, online 📅